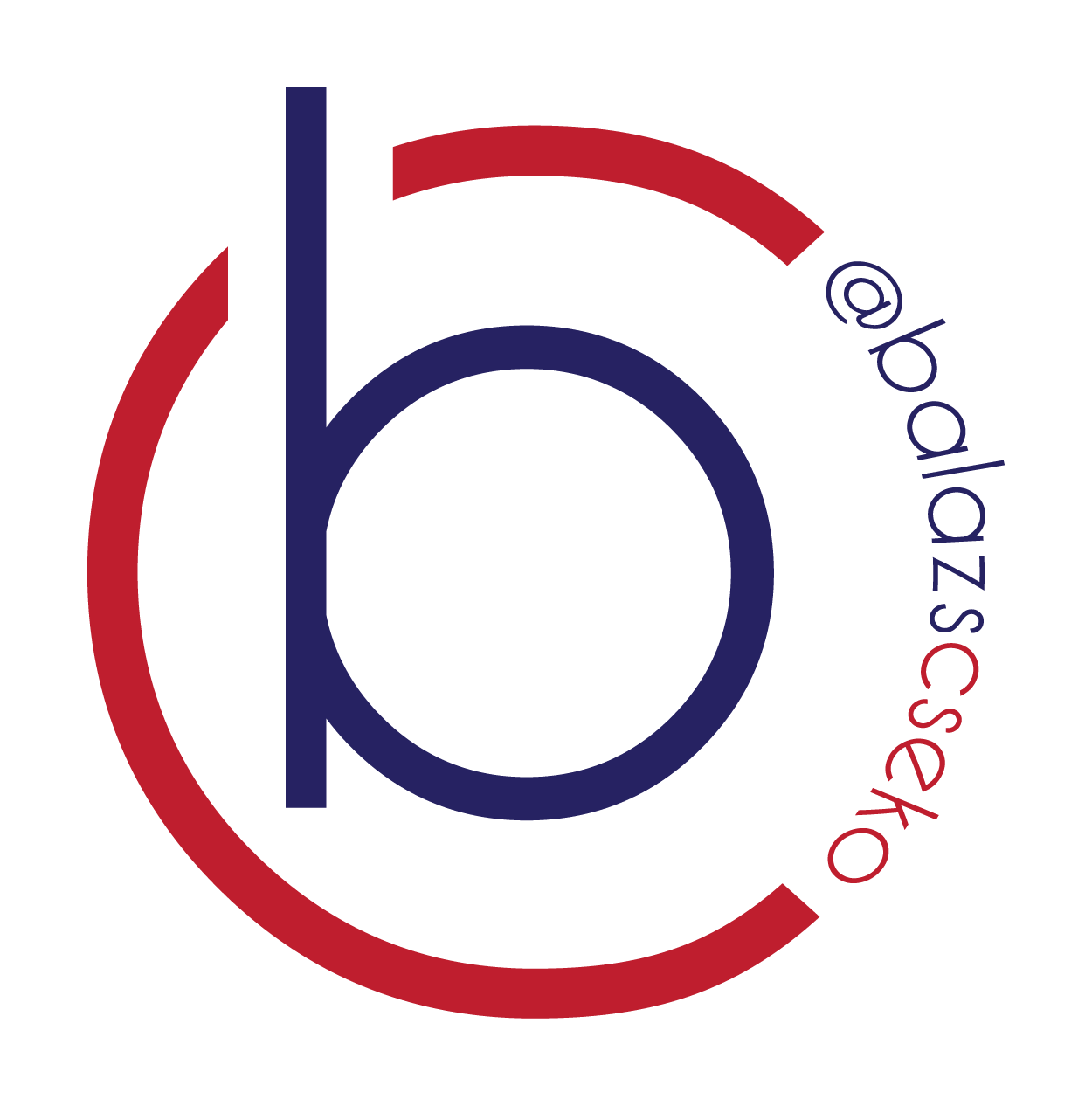Der kubanische Soziologe Jorge Hernández steht der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen mit den USA reserviert gegenüber. Unter der "Öffnung der kubanischen Gesellschaft" verstehe US-Präsident Barack Obama nur die wachsende Rolle des Marktes. Die Geschichte könne man nicht so einfach vergessen. Trotzdem hofft Hernández, dass der nächste US-Präsident kein Republikaner ist, sondern das Weißes Haus in der Hand der Demokraten bleibt.
STANDARD: Als erster US-Präsident seit 88 Jahren hat Barack Obama Kuba besucht. Wie hat dieser Besuch die US-Kuba-Beziehungen beeinflusst?
Hernández: Obamas Besuch hat dazu beigetragen, den Annäherungsprozess realistischer zu betrachten. In seiner Rede im Gran Teatro von Havanna stellte Obama seine Absichten klar und dämpfte den ursprünglichen Optimismus. Er machte deutlich, was er von den bilateralen Beziehungen erwartet und welche Forderungen er an Kuba stellt.
STANDARD: An welche Forderungen denken Sie?
Hernández: Unter der "Öffnung der kubanischen Gesellschaft" versteht er die wachsende Rolle des Marktes. Was wir in Kuba cuentapropismo (Arbeit auf eigene Faust) nennen, sind in Wirklichkeit kleine und mittlere Unternehmen. Die von Obama geforderte Öffnung versteht sich als die Etablierung, Erweiterung und Konsolidierung der Gesamtheit der kapitalistischen Verhältnisse innerhalb der kubanischen Gesellschaft.
STANDARD: Ebenso hat Obama für die Rechte der Opposition und für mehr Demokratie plädiert.
Hernández: Obama traf sich mit oppositionellen Gruppen, die vor dem Besuch sehr optimistisch gestimmt waren. Sie hatten auf ein Treffen mit mehr Öffentlichkeit und Resonanz gehofft. Schlussendlich versammelten sie sich in der Residenz des US-Botschafters. Dazu waren auch nicht alle Gruppen eingeladen, weil es davor bereits eine Auswahl gegeben hatte. Das hinterließ eine Art Frustrationsgefühl. Ein Teil der Opposition verfügte über Legitimität. Bestimmte Gruppen aber, die im Zusammenhang mit den Umsturzaktivitäten der US-Geheimdienste gegründet wurden, jedoch nicht. Die Bewegung "Damen in Weiß" beispielsweise bekommt finanzielle, moralische und logistische Unterstützung der US-Regierung. Sie agieren oft wie "Angestellte" der USA.
STANDARD: Inwieweit verändert sich die Situation der oppositionellen Gruppen durch die Annäherungspolitik?
Hernández: Diese Gruppen waren in Kuba bereits vor der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen mit den USA aktiv. Wir haben jetzt ein Szenario, in dem wir uns von Konfrontation und Feindseligkeit hin zu Dialog, Gespräch und Problemlösung bewegt haben. Deshalb verlieren diese Kreise ihre Funktion. Sie sind nur noch ein Stein im Schuh.
STANDARD: Einer der wichtigsten Sätze Obamas während seines Havanna-Aufenthalts war: "Lassen wir die Vergangenheit, schauen wir in die Zukunft." Ist es möglich, nach sechs Jahrzehnten der Feindseligkeit plötzlich die Vergangenheit zu vergessen?
Hernández: Der US-Philosoph George Santayana sagte einmal: "Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen." Das ist ein sehr passender Spruch, um zu verstehen, was Kuba passieren kann, wenn es seine Geschichte vergisst. Trotzdem sieht es danach aus, dass der US-Präsident daran glaubt, dass man die Geschichte vergessen kann. Das Bestreben, dass die Kubaner ihr Gedächtnis verlieren, ist sehr stark. Es ist eine dramatische Geschichte mit zahlreichen Opfern, Menschen, die bei terroristischen Angriffen getötet wurden. Im Bereich der Bildung, der Volksgesundheit und der Menschenrechte bezahlt Kuba für das Embargo einen enormen Preis. Die Geschichte kann man nicht vergessen.
STANDARD: Der US-Präsident kann das Handelsembargo nicht allein aufheben.
Hernández: Seit der Verabschiedung des Helms-Burton Act im Jahr 1996 fällt das Embargo in den Zuständigkeitsbereich des Kongresses. Der Präsident hat bestimmte Vorrechte, braucht aber die Unterstützung des Kongresses. Es wurden Botschaften in beiden Ländern geöffnet, der Tonfall auf beiden Seiten ist gemäßigter geworden. Seit der Ankündigung der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen am 17. Dezember 2014 erfolgt die Auseinandersetzung nicht mehr im Boxring, sondern auf dem Schachbrett.

STANDARD: Warum kam es ausgerechnet im März 2016 zum Staatsbesuch des US-Präsidenten?
Hernández: Der Besuch hat Symbolwert. Damit wollte Obama der kubanischen Gesellschaft, Lateinamerika und der Welt seinen Willen zum Handeln zeigen. Statt Konflikte und Kriege bevorzugt er die öffentliche Diplomatie. Da es sein letztes Jahr im Weißen Haus ist, will er auch der Nachwelt etwas hinterlassen. Er will das Image eines Präsidenten haben, der fähig war, das zu schaffen, was seine Amtskollegen jahrzehntelang nicht lösen konnten. Einer der Gründe für das Timing war aber auch, dass er den Besuch noch vor dem VII. Kongress der Kubanischen Kommunistischen Partei absolvieren wollte. Mit der Absicht, zu sehen, wie die Partei auf die neue Phase der USA-Kuba-Beziehungen reagiert. Hand in Hand damit geht der Versuch, seinem Nachfolger den Weg zu ebnen und den Annäherungsprozess in seinen letzten Monaten im Amt voranzubringen, damit er unumkehrbar wird. Für Obama ist es ein Kampf gegen die Zeit. Der Besuch kann ebenfalls als ein Angebot der Demokratischen Partei von Hillary Clinton und Bernie Sanders verstanden werden. Sollte einer der beiden gewinnen, gibt es eine Kontinuität mit der Kuba-Politik der Obama-Regierung.
STANDARD: Es könnte aber sein, dass den nächsten Präsidenten die Republikanische Partei stellt.
Hernández: Eine solche Situation wäre für Kuba äußerst schwierig. So ein Fall würde Obamas Anhänger entmutigen. Es könnte verschiedene Szenarien geben. Das schlimmste davon wäre ein Republikaner als Präsident mit einer Mehrheit der Republikanischen Partei in beiden Kammern des US-Kongresses. Weniger ungünstig wäre das Szenario, wenn die Demokraten zumindest eine Kammer des Kongresses kontrollieren könnten. Der Idealfall wäre trotzdem ein Demokrat im Weißen Haus. Die große Frage ist, ob Obamas Kuba-Politik dem Interesse seiner Regierung oder dem Staatsinteresse entspricht. Eine Antwort darauf liefert nur die Zeit.
STANDARD: Welchen Einfluss hat der Kuschelkurs mit den USA auf die kubanische Gesellschaft?
Hernández: Es ist möglich, dass der ideologische Standpunkt überwiegen wird. Dann könnten wir noch immer über Kommunismus sprechen. Der pragmatische Standpunkt im Einklang mit der traditionellen Kultur der US-Amerikaner könnte ebenso vorherrschen. Allerdings muss man die Positionen der kubanischen Regierung berücksichtigen. Innerhalb der Regierung gibt es Kreise, die den Prozess mit Sorge beobachten. Diese Meinung vertritt auch Fidel Castro, der den Regierenden der USA nie vertraut hat. ("Der Standard", 4.5.2016)
Jorge Hernández Martínez (Jahrgang 1949) ist ein kubanischer Soziologe und Professor an der Universität von Havanna. Seit 1998 leitet er den kubanischen Thinktank Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos.
Fotos: Balazs Csekö
Der kubanische Soziologe Jorge Hernández steht der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen mit den USA reserviert gegenüber. Unter der "Öffnung der kubanischen Gesellschaft" verstehe US-Präsident Barack Obama nur die wachsende Rolle des Marktes. Die Geschichte könne man nicht so einfach vergessen. Trotzdem hofft Hernández, dass der nächste US-Präsident kein Republikaner ist, sondern das Weißes Haus in der Hand der Demokraten bleibt. STANDARD: Als erster US-Präsident seit 88 Jahren hat Barack Obama Kuba besucht. Wie hat dieser Besuch die US-Kuba-Beziehungen beeinflusst? Hernández: Obamas Besuch hat dazu beigetragen, den Annäherungsprozess realistischer zu betrachten. In seiner Rede im Gran Teatro von Havanna stellte Obama seine Absichten klar und dämpfte den ursprünglichen Optimismus. Er machte deutlich, was er von den bilateralen Beziehungen erwartet und welche Forderungen er an Kuba stellt. STANDARD: An welche Forderungen denken Sie? Hernández: Unter der "Öffnung der kubanischen Gesellschaft" versteht er die wachsende Rolle des Marktes. Was wir in Kuba cuentapropismo (Arbeit auf eigene Faust) nennen, sind in Wirklichkeit kleine und mittlere Unternehmen. Die von Obama geforderte Öffnung versteht sich als die Etablierung, Erweiterung und Konsolidierung der Gesamtheit der kapitalistischen Verhältnisse innerhalb der kubanischen Gesellschaft. STANDARD: Ebenso hat Obama für die Rechte der Opposition und für mehr Demokratie plädiert. Hernández: Obama traf sich mit oppositionellen Gruppen, die vor dem Besuch sehr optimistisch gestimmt waren. Sie hatten auf ein Treffen mit mehr Öffentlichkeit und Resonanz gehofft. Schlussendlich versammelten sie sich in der Residenz des US-Botschafters. Dazu waren auch nicht alle Gruppen eingeladen, weil es davor bereits eine Auswahl gegeben hatte. Das hinterließ eine Art Frustrationsgefühl. Ein Teil der Opposition verfügte über Legitimität. Bestimmte Gruppen aber, die im Zusammenhang mit den Umsturzaktivitäten der US-Geheimdienste gegründet wurden, jedoch nicht. Die Bewegung "Damen in Weiß" beispielsweise bekommt finanzielle, moralische und logistische Unterstützung der US-Regierung. Sie agieren oft wie "Angestellte" der USA. STANDARD: Inwieweit verändert sich die Situation der oppositionellen Gruppen durch die Annäherungspolitik? Hernández: Diese Gruppen waren in Kuba bereits vor der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen mit den USA aktiv. Wir haben jetzt ein Szenario, in dem wir uns von Konfrontation und Feindseligkeit hin zu Dialog, Gespräch und Problemlösung bewegt haben. Deshalb verlieren diese Kreise ihre Funktion. Sie sind nur noch ein Stein im Schuh. STANDARD: Einer der wichtigsten Sätze Obamas während seines Havanna-Aufenthalts war: "Lassen wir die Vergangenheit, schauen wir in die Zukunft." Ist es möglich, nach sechs Jahrzehnten der Feindseligkeit plötzlich die Vergangenheit zu vergessen? Hernández: Der US-Philosoph George Santayana sagte einmal: "Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen." Das ist ein sehr passender Spruch, um zu verstehen, was Kuba passieren kann, wenn es seine Geschichte vergisst. Trotzdem sieht es danach aus, dass der US-Präsident daran glaubt, dass man die Geschichte vergessen kann. Das Bestreben, dass die Kubaner ihr Gedächtnis verlieren, ist sehr stark. Es ist eine dramatische Geschichte mit zahlreichen Opfern, Menschen, die bei terroristischen Angriffen getötet wurden. Im Bereich der Bildung, der Volksgesundheit und der Menschenrechte bezahlt Kuba für das Embargo einen enormen Preis. Die Geschichte kann man nicht vergessen. STANDARD: Der US-Präsident kann das Handelsembargo nicht allein aufheben. Hernández: Seit der Verabschiedung des Helms-Burton Act im Jahr 1996 fällt das Embargo in den Zuständigkeitsbereich des Kongresses. Der Präsident hat bestimmte Vorrechte, braucht aber die Unterstützung des Kongresses. Es wurden Botschaften in beiden Ländern geöffnet, der Tonfall auf beiden Seiten ist gemäßigter geworden. Seit der Ankündigung der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen am 17. Dezember 2014 erfolgt die Auseinandersetzung nicht mehr im Boxring, sondern auf dem Schachbrett. STANDARD: Warum kam es ausgerechnet im März 2016 zum Staatsbesuch des US-Präsidenten? Hernández: Der Besuch hat Symbolwert. Damit wollte Obama der kubanischen Gesellschaft, Lateinamerika und der Welt seinen Willen zum Handeln zeigen. Statt Konflikte und Kriege bevorzugt er die öffentliche Diplomatie. Da es sein letztes Jahr im Weißen Haus ist, will er auch der Nachwelt etwas hinterlassen. Er will das Image eines Präsidenten haben, der fähig war, das zu schaffen, was seine Amtskollegen jahrzehntelang nicht lösen konnten. Einer der Gründe für das Timing war aber auch, dass er den Besuch noch vor dem VII. Kongress der Kubanischen Kommunistischen Partei absolvieren wollte. Mit der Absicht, zu sehen, wie die Partei auf die neue Phase der USA-Kuba-Beziehungen reagiert. Hand in Hand damit geht der Versuch, seinem Nachfolger den Weg zu ebnen und den Annäherungsprozess in seinen letzten Monaten im Amt voranzubringen, damit er unumkehrbar wird. Für Obama ist es ein Kampf gegen die Zeit. Der Besuch kann ebenfalls als ein Angebot der Demokratischen Partei von Hillary Clinton und Bernie Sanders verstanden werden. Sollte einer der beiden gewinnen, gibt es eine Kontinuität mit der Kuba-Politik der Obama-Regierung. STANDARD: Es könnte aber sein, dass den nächsten Präsidenten die Republikanische Partei stellt. Hernández: Eine solche Situation wäre für Kuba äußerst schwierig. So ein Fall würde Obamas Anhänger entmutigen. Es könnte verschiedene Szenarien geben. Das schlimmste davon wäre ein Republikaner als Präsident mit einer Mehrheit der Republikanischen Partei in beiden Kammern des US-Kongresses. Weniger ungünstig wäre das Szenario, wenn die Demokraten zumindest eine Kammer des Kongresses kontrollieren könnten. Der Idealfall wäre trotzdem ein Demokrat im Weißen Haus. Die große Frage ist, ob Obamas Kuba-Politik dem Interesse seiner Regierung oder dem Staatsinteresse entspricht. Eine Antwort darauf liefert nur die Zeit. STANDARD: Welchen Einfluss hat der Kuschelkurs mit den USA auf die kubanische Gesellschaft? Hernández: Es ist möglich, dass der ideologische Standpunkt überwiegen wird. Dann könnten wir noch immer über Kommunismus sprechen. Der pragmatische Standpunkt im Einklang mit der traditionellen Kultur der US-Amerikaner könnte ebenso vorherrschen. Allerdings muss man die Positionen der kubanischen Regierung berücksichtigen. Innerhalb der Regierung gibt es Kreise, die den Prozess mit Sorge beobachten. Diese Meinung vertritt auch Fidel Castro, der den Regierenden der USA nie vertraut hat. (Balazs Csekö, 4.5.2016) Jorge Hernández Martínez (Jahrgang 1949) ist ein kubanischer Soziologe und Professor an der Universität von Havanna. Seit 1998 leitet er den kubanischen Thinktank Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. - derstandard.at/2000036155627-1263705461174/Auch-Fidel-Castro-beobachtet-den-Prozess-mit-Sorge