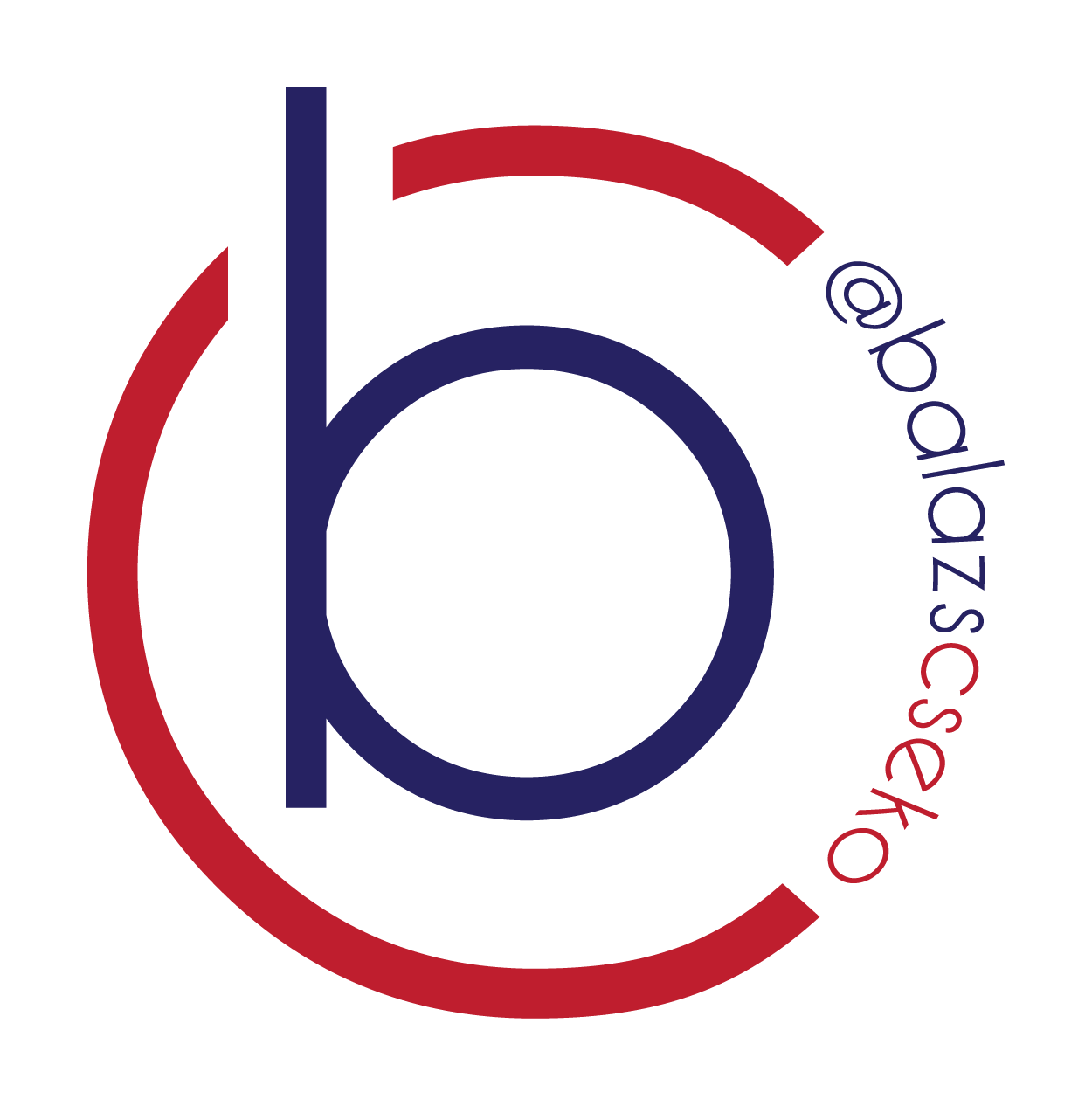"Wir könnten viel mehr Menschenleben retten", ist Sandra Hamammy überzeugt. Ihr Blick ist ernst, sie wirkt enttäuscht, zermürbt von den Strapazen ihrer Arbeit. Dennoch ist sie voller Tatendrang. Schon seit Jahren ist die Deutsche im Mittelmeer unterwegs und arbeitet für die deutsche Hilfsorganisation Sea Watch. Sie hat schon vieles gesehen, kaum etwas davon ist leicht zu verdauen. "Wenn man tote Kinder bergen muss, prägt sich das ein." Doch Tragödien dieser Art entmutigen sie nicht. Psychisch sind Situationen wie diese belastend. Zeitgleich bekräftigt die große Anzahl der geretteten Personen die Überzeugung, das Richtige zu tun.
Was ihr keine Ruhe lässt, ist das Wissen, dass durch eine bessere Zusammenarbeit der vor Ort befindlichen Helfer mehr Leben gerettet werden könnten. "Eine effektive Kooperation der Behörden mit uns könnte vieles ändern", ist sie überzeugt.
Sandra ist seit September auf der griechischen Insel Lesbos. Davor arbeitete sie längere Zeit auf Lampedusa. Vor den Pelagischen Inseln, in der Straße von Sizilien, rettete sie als Mitglied des zivilen Seenotrettungsteams Sea Watch aus Afrika kommende Flüchtlinge vor dem Ertrinken. Ihre Arbeit ist dieselbe geblieben, nur der Einsatzort hat sich geändert.
Sea Watch ist einer von zahlreichen Akteuren, die in der Gegend auf offenem Meer patrouillieren. Obwohl alle Beteiligten das gleiche Ziel haben, Menschen zu helfen, klappt die Zusammenarbeit zwischen zivilen und behördlichen Helfern nur in den wenigsten Fällen. "Die staatlichen Behörden machen unsere Aufgaben nicht leichter", sagt Sandra.
In den ägäischen Gewässern fahren die Boote von Nichtregierungsorganisationen zwischen wesentlich größeren Schiffen der griechischen und türkischen Küstenwache. Aufgrund der Überforderung und der Kapazitätsgrenzen der griechischen Behörden greift Frontex, die Behörde für operative Zusammenarbeit an den EU-Außengrenzen, den Griechen unter die Arme.
"Leiden können wir nicht alle retten"
Im Rahmen der Poseidon Rapid Intervention Mission von Frontex, die offiziell Ende Dezember ins Leben gerufen wurde, erfüllen Marinepolizisten mehrerer europäischer Länder zusammen einen Grenzsicherungsauftrag. Ein portugiesisches Team ist für die Küstenstrecke zwischen der malerischen Ortschaft Petra und dem weißen Leuchtturm beim Kap Korakas zuständig. "Wir geben unser Bestes, leider können wir nicht alle retten", sagt Filipe, ein Frontex-Mitarbeiter aus Lissabon.
Der großgewachsene Polizist ist beinahe täglich in der Meerenge zwischen der Türkei und Lesbos unterwegs. Auch er hat schon vieles erlebt. "Die Zusammenarbeit mit den zivilen Helfern funktioniert gut", meint er und bezieht sich auf einen vor kurzem geschehenen Vorfall. "Vor zwei Wochen sind wir zur Rettung eines Bootes hinausgefahren. Es war Nacht. Als wir dort ankamen, sahen wir eine völlig durchnässte und halberfrorene Gruppe von Flüchtlingen auf einem kleinen Schlauchboot. Wir haben die Insassen auf unser Boot geholt, doch uns wurde gesagt, dass kurz davor einer ins Wasser gefallen ist", erzählt Filipe.
Die Frontex-Crew stand vor der Entscheidung, mit den unterkühlten Passagieren die eine Person zu suchen, die womöglich nicht mehr lebte, oder zuerst die Flüchtlinge zu einem nahegelegenen Hafen zu bringen und sie dort verpflegen zu lassen. In solchen Fällen hat der Kapitän immer das letzte Wort. "Das ist natürlich keine leichte Entscheidung", sagt Kapitän Paolo. "In dem Moment muss kalkuliert werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die Person innerhalb einer kurzen Zeit zu finden, bevor die Geretteten an Bord schwere gesundheitliche Schäden durch die Hypothermie erleiden." Die Crew entschied sich damals, zuerst die Insassen an Land zu bringen, und bat gleichzeitig zahlreiche vor Ort agierende zivile Helfer um Hilfe.
Streitigkeiten und Kompetenzwirrwarr
Die Kommunikation lief über Radio Juliet, auf der Funkfrequenz 87. Diese Radiostation wurde von Greenpeace und den Ärzten ohne Grenzen aufgebaut, um die Koordinierung zwischen den privaten Initiativen effizienter zu gestalten. Der Kanal 87 wird aber auch ständig auf den Booten der Frontex abgehört, die bei Bedarf mit den zivilen Helfern interagieren. So auch in dem besagten Fall: "Wir haben per Kanal 87 um Hilfe gebeten, die Koordinaten durchgegeben, wo sich die Person in etwa befinden könnte", erinnert sich Filipe. "Es dauerte nicht lange, bis Proactiva in die See stach. Sie konnten die Person nach einiger Zeit finden und retten."
Proactiva Open Arms ist eine aus spanischen Rettungsschwimmern bestehende Rettungsmannschaft. Sie sind mit Jetskis und schnellen Booten im Norden der Insel unterwegs. Daneben gibt es noch andere Retter aus der Zivilgesellschaft. Die dänische NGO Team Humanity agiert mit einem geliehenen Boot im Südosten der Insel. Sie arbeiten sehr häufig mit den spanischen Helfern von Proem Aid zusammen. Auch Greenpeace und Ärzte ohne Grenzen sind gemeinsam mit Booten in der Ägäis unterwegs. Und im Nordosten der Insel, in dem kleinen, verschlafenen Dorf Tsonia, hat der Verein Sea Watch der deutschen Flüchtlingsaktivistin Sandra seine Zentrale.
Nach mehrmaligem Nachfragen gibt Frontex-Mitarbeiter Filipe zu, dass es zu Streitigkeiten zwischen zivilen Seenotrettern und den Behörden kommt. Vor allem dann, wenn diese Flüchtlingsboote an Land ziehen. Toleriert wird das von der griechischen Küstenwache, die für die Koordinierung des Geschehens in den griechischen Gewässern zuständig ist, kaum. Das Schleppen von Booten sei aber oft notwendig, verteidigt der Sea-Watch-Taucher Sascha solche Aktionen. "Wenn der Motor ausfällt oder der Sprit ausgeht, bleibt uns nichts anderes übrig." Ähnlich argumentiert seine Kollegin Sandra: "Sieht man ein Schiff in Seenot, muss man helfen. Das ist eine Duty-to-rescue-Situation." Wer den Seenotfall deklariert, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. "Für uns ist ein Boot auf dem Wasser, das mit zu vielen Personen beladen ist, ein Seenotfall", sagt sie.
Die Frontex wiederum argumentiert, dass einen Seenotfall die griechischen Behörden zu bestimmen haben. "Wir melden die Lage den lokalen Behörden und handeln nach ihren Anweisungen. Die zivilen Helfer melden uns manchmal nicht einmal die Situation, sondern handeln nach ihrem Gutdünken. Das geht so nicht", sagt Frontex-Polizist Filipe.
Strafen wegen Schlepperei
In den Gewässern vor Lesbos ist ein regelrechter Kampf um die Befehlshoheit entstanden. Wer darf was entscheiden, und wer muss was wem und wann melden – darüber wird häufig gestritten. Drohungen der Behörden bleiben da nicht aus. "Sie schreien mit uns, dass wir das nächste Mal verhaftet werden." Strafandrohungen der Küstenwache beeindrucken die zivilen Helfer kaum. Weder von einer Haft- noch von einer Geldstrafe fühlen sich die beiden Aktivisten verunsichert. "Ob ich am Ende irgendwelche Geldstrafen zahlen muss, ist egal. Ich bin hier, um zu helfen. Wenn ich Angst vor Strafen hätte, bräuchte ich auch nicht da sein", erklärt Sascha.
Dass aber Drohungen zur Realität werden können, zeigt das Beispiel der spanischen Proem-Aid-Crew. Drei spanische Feuerwehrleute wurden unlängst von der griechischen Küstenwache festgenommen. Sie hatten vor ihrer Festnahme ihre übliche Tätigkeit, Seenotrettung in den Gewässern zwischen der Türkei und Lesbos, ausgeübt. Erst nachdem sie zwei Nächte in einer Zelle verbracht und 5.000 Euro pro Person als Kaution bezahlt hatten, wurden sie entlassen. Ihnen wird Schlepperei vorgeworfen, die mit bis zu vier Jahren Haft bestraft werden kann. "Es war reine Willkür", sagt Sandra, "uns könnte das ebenfalls passieren."
Machtspiele in den Gewässern
Die Sea-Watch-Mitarbeiterin sieht darin den Versuch, die zivile Seenotrettung einzudämmen. "Sinnvoll ist das nicht, denn unsere Hilfe beanspruchen sie ständig, und je wärmer es wird, desto mehr werden sie uns brauchen. Sie wollen nur demonstrieren, wer hier das Sagen hat." Für die zivilen Helfer ist das unverständlich, sehen sie die Notwendigkeit ihrer Arbeit doch sowieso nur in den Versäumnissen der europäischen Behörden. "Wir machen privat, was die EU verabsäumt. Die Boote der Behörden reichen, wie so viele Beispiele zeigen, nicht aus", erklärt die deutsche Aktivistin. "Zudem fehlt es den Behörden sehr häufig an einem humanen Umgang mit den Flüchtlingen, häufig sind auch keine Übersetzer und kein medizinisches Personal auf den Booten der Behörden. All diese Lücken versuchen wir zu füllen."
Laut Aussagen eines griechischen Offiziers, der anonym bleiben möchte, läuft die Zusammenarbeit zwischen der türkischen und der griechischen Seite auch nicht reibungslos. "Eine Zusammenarbeit gibt es nur auf dem Papier", sagt der griechische Marinepolizist. Ob die türkische Seite der eigenen Verpflichtung nachkommt, sei fragwürdig. "Oft umkreisen die Türken die Schlauchboote und tun nichts. Wir sehen das auf unserem Radar." Wenn nötig, fahren die Frontex-Boote in die türkischen Gewässer, um Hilfe zu leisten. "Die türkischen Behörden sehen das sicherlich nicht gerne, aber bis jetzt haben sie uns nicht daran gehindert", sagt der griechische Polizist.
Neuer Player im Spiel
Um die Situation auf dem Wasser noch undurchsichtiger zu machen, gibt es seit kurzem einen neuen Akteur in der Region. Große Schiffe der Nato sind in der Ägäis aufgetaucht. Sie sollen Menschenschmuggel und die illegalen Migrationskanäle bekämpfen. Wie die Nato-Schiffe die Situation in der Ägäis verändern werden, können die Beteiligten schwer abschätzen. "Eines ist aber klar: Da die Türkei ebenfalls Nato-Mitglied ist, können die Nato-Schiffe auch türkische Häfen problemlos anfahren", gibt Sascha zu bedenken, dass dadurch eine Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei schon vom Wasser mühelos möglich wäre.
Für Sandra würde das aber nur zur Folge haben, dass die Flüchtlinge dann "auf noch gefährlichere Routen" ausweichen würden. Wenn es dazu kommen würde, werden Sandra und andere zivile Helfer sich auf den Weg machen, um dort die "Versäumnisse" der EU auszugleichen. "Falls den Behörden die Rettung von Menschenleben wirklich am Herzen liegt, sollten sie den Flüchtlingen eine Safe Passage (sichere Überfahrt, Anm.) ermöglichen und die zivilen Initiativen nicht an ihrer Arbeit hindern", sagt Sandra. "Denn in den ägäischen Gewässern sind schon zu viele Menschen umgekommen." ("Der Standard", 15.3. 2016 - mit Siniša Puktalović)
Foto: Balazs Csekö